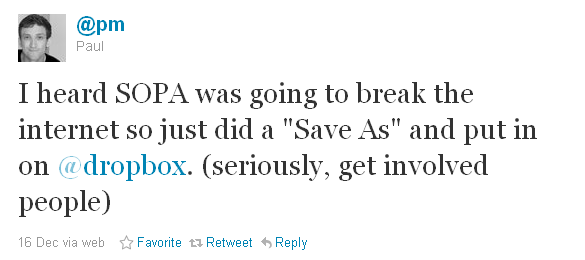Lewis Carroll
Alice was walking beside the White Knight in Looking Glass Land.”You are sad.” the Knight said in an anxious tone: “let me sing you a song to comfort you.”
“Is it very long?” Alice asked, for she had heard a good deal of poetry that day.
“It’s long.” said the Knight, “but it’s very, very beautiful. Everybody that hears me sing it – either it brings tears to their eyes, or else -”
“Or else what?” said Alice, for the Knight had made a sudden pause.
“Or else it doesn’t, you know. The name of the song is called ‘Haddocks’ Eyes.'”
“Oh, that’s the name of the song, is it?” Alice said, trying to feel interested.
“No, you don’t understand,” the Knight said, looking a little vexed. “That’s what the name is called. The name really is ‘The Aged, Aged Man.'”
“Then I ought to have said ‘That’s what the song is called’?” Alice corrected herself.
“No you oughtn’t: that’s another thing. The song is called ‘Ways and Means’ but that’s only what it’s called, you know!”
“Well, what is the song then?” said Alice, who was by this time completely bewildered.
“I was coming to that,” the Knight said. “The song really is ‘A-sitting On a Gate’: and the tune’s my own invention.”
Lewis Carroll, Through the Looking-Glass
Cusanus
Unum igitur verum nomen cuiusque imparticipabile atque, uti est, ineffabile esse necesse est.
Nikolaus von Kues, De coniecturis, 101.
Wittgenstein
Die Gegenstände kann ich nur nennen. Zeichen vertreten sie. Ich kann nur von ihnen sprechen, sie aussprechen kann ich nicht. Ein Satz kann nur sagen, wie ein Ding ist, nicht was es ist. (3.221)
Der Name bedeutet den Gegenstand. Der Gegenstand ist seine Bedeutung. (3.203)
Der Satz besitzt wesentliche und zufällige Züge. Zufällig sind die Züge, die von der besonderen Art der Hervorbringung des Satzzeichens herrühren. Wesentlich diejenigen, welche allein den Satz befähigen, seinen Sinn auszudrücken.(3.34) Der eigentliche Name ist das, was alle Symbole, die den Gegenstand bezeichnen, gemeinsam haben. Es würde sich so successive ergeben, dass keinerlei Zusammensetzung für den Namen wesentlich ist. (3.3411) Ein Name steht für ein Ding, ein anderer für ein anderes Ding und untereinander sind sie verbunden, so stellt das Ganze – wie ein lebendes Bild – den Sachverhalt vor. (4.0311) Können wir zwei Namen verstehen, ohne zu wissen, ob sie dasselbe Ding oder zwei verschiedene Dinge bezeichnen? – Können wir einen Satz, worin zwei Namen vorkommen, verstehen, ohne zu wissen, ob sie Dasselbe oder Verschiedenes bedeuten?
Kenne ich etwa die Bedeutung eines englischen und eines gleichbedeutenden deutschen Wortes, so ist es unmöglich, dass ich nicht weiß, dass die beiden gleichbedeutend sind; es ist unmöglich, dass ich sie nicht ineinander übersetzen kann. (4.243)
Ludwig Wittgenstein, Tractatus
My Heart and Lute
I give thee all -I can no more-
Tho’ poor the offering be;
My heart and lute are all the store
That I can bring to thee.
A lute whose gentle song reveals
The soul of love full well;
And, better far, a heart that feels
Much more than lute could tell.Tho’ love and song may fail, alas!
To keep life’s clouds away,
At least ’twill make them lighter pass,
Or gild them if they stay.
And even if Care at moments flings
A discord o’er life’s happy strain,
Let Love but gently touch the strings,
‘Twill all be sweet again!
Thomas Moore… und was das mit Liquid Democracy zu tun hat:
“Frei, gleich – geheim?”




 “Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einizige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradise her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.”
“Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einizige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradise her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.”